|
Die "neue"
Frauenbewegung (ab etwa 1969):
"Der Frau die Hälfte der Welt — dem Mann die Hälfte des Hauses"
Ende der sechziger Jahre war die Zeit der
Studenten- und Friedensbewegung. Studenten entwarfen Flugblätter und
Resolutionen, diskutierten und demonstrierten gegen "den Muff von 1000
Jahren" an den Universitäten, gegen Spießbürgertum und für
Selbstbestimmung. Die in den gleichen Organisationen tätigen Studentinnen
leisteten ihren Beitrag in der neuen Bewegung, indem sie für ihre Kommilitonen
kochten, die Manuskripte abtippten und die Kinder betreuten. Als die
Studentinnen diese ungerechte Aufgabenverteilung der Geschlechter auf die
Tagesordnung setzen wollten, wurden sie von den Studenten abgeschmettert. Ihre
Forderungen seien unpolitisch, der Widerspruch zwischen den Geschlechtern sei
ein "Nebenwiderspruch", der sich von selbst lösen würde, sobald sich
der "Hauptwiderspruch", die Klassengesellschaft, aufgelöst habe. Es
kam zum Eklat. Studentinnen begannen sich autonom in sogenannten
"Weiberräten" zu organisieren. Sie wollten sich unter Ausschluss
männlicher Mitglieder intensiv mit der Rolle der Frau auseinandersetzen.
Beispiel Deutschland: Als Geburtsstunde der
neuen deutschen Frauenbewegung gilt der Erste Bundesfrauenkongress in Frankfurt
am Main, an dem 450 Frauen aus 40 Frauengruppen teilnahmen. In der
Eröffnungsrede heißt es: "Privilegierte haben in der Geschichte ihre
Rechte noch nie freiwillig preisgegeben. Deshalb fordern wir: Frauen müssen ein
Machtfaktor innerhalb der ausstehenden Auseinandersetzungen werden! Frauen
müssen sich selbst organisieren, weil sie ihre ureigensten Probleme erkennen
und lernen müssen, ihre Interessen zu vertreten!"
Die Frauen waren in kleinen Gruppen organisiert
und lehnten größere Verbände oder Parteien ab, da sie keine festen
Machtstrukturen aufbauen wollten. Die Feministinnen waren in ihren Zielen,
Vorgehensweisen und Ideen heterogen und arbeiteten in allen gesellschaftlichen
Gebieten (sozial, kulturell, politisch, wissenschaftlich, medizinisch etc.).
Obwohl der Kern der Frauenbewegung unabhängig organisiert blieb, sorgten
später einzelne Feministinnen in staatlichen Institutionen oder in Parteien
für die Durchsetzung vieler Forderungen und Ideen. Einige Beispiele
für Veränderungen durch die
Frauenbewegung:
Alltag:
Die Frauen der Studentenbewegung lebten
zunächst in Wohngemeinschaften mit ihren männlichen Kommilitonen. Im Zuge der
Frauenbewegung gründeten sie jedoch mehr und mehr eigene
Frauenwohngemeinschaften. Sie waren die endlosen Diskussionen um chaotische
Küchen, leere Kühlschränke und dreckige Klobrillen genauso leid wie den
"Bumszwang". Hier versuchten sie, neue "weibliche" Formen
des Zusammenlebens auszuprobieren. Frauen wollten mit Frauen zusammen leben,
reisen, diskutieren und lernen.
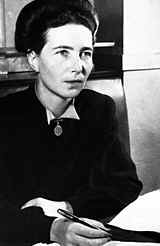
[Simone de Beauvoir] |
Und es waren
nicht nur die Studentinnen, die neue Wege des Zusammenlebens suchten. Auch
bei anderen Frauen wuchs das Bedürfnis, die eigene Stellung in der
Familie, im Beruf und in der Gesellschaft zu thematisieren. Es entstanden
zahlreiche Selbsterfahrungsgruppen, in denen die eigenen Probleme — oft
zum ersten Mal — ausgesprochen und Strategien für den politischen wie
auch den "häuslichen Kampf" diskutiert wurden. Die Entdeckung,
dass die scheinbar privaten und individuellen Probleme sich ähnelten,
bildete die Basis für die Solidarität in der Gruppe und mit Frauen
insgesamt und ermöglichte das Hinterfragen der gesellschaftlichen
Bedingungen ihrer Situation. Der Satz "Das
Private ist politisch" wurde ein wichtiger Leitgedanke der
Frauenbewegung.
Ein wichtiger Bezugspunkt war die
Lektüre. Simone de Beauvoirs "Das andere Geschlecht", Betty
Friedans "Der Weiblichkeitswahn", Kate Millets "Sexus und
Herrschaft", Alice Schwarzers "Der kleine Unterschied und seine
großen Folgen" sowie die Ergebnisse der Frauen- und
Matriarchatsforschung wurden von vielen Frauen gelesen und führten mit
dazu, dass das bisherige Geschlechterverhältnis grundsätzlich in Frage
gestellt wurde. |
Kindererziehung:
Zu den "Feministinnen der ersten
Stunde" zählten viele Mütter. Sie gründeten "Kinderläden" zur
Kinderbetreuung und setzten sich mit grundsätzlichen Erziehungsfragen
auseinander: sie diskutierten geschlechtsspezifische Rollenzuschreibungen im
Kindesalter repressionsfreie Erziehungsmethoden — die sogenannte
"antiautoritäre Erziehung" war geboren. "Kinderläden" und
freie Schulen entwickelten sich parallel zur Frauenbewegung und waren mit
frauenpolitischen Diskussionen z.B. über die Rolle der Mutter verknüpft. An
der Kinderfrage entzündeten sich später Diskussionen innerhalb der
Frauenbewegung.
| Selbstbestimmungsrecht:
Im Mittelpunkt öffentlicher Aktionen
stand das Selbstbestimmungsrecht der Frau über ihren Körper. Der Kampf
um die Legalisierung der Abtreibung wurde in vielen Ländern aufgenommen
und von Frauen aller Schichten mitgetragen. Er begann in Frankreich mit
einer öffentlichen Selbstbezichtigung von 344 Frauen als politischer
Appell für die Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs. Diese Aktion
wurde von einer wichtigen deutschen Protagonistin des Feminismus, Alice
Schwarzer, die in Frankreich als Korrespondentin arbeitete, in Deutschland
wiederholt. Der öffentliche Appell wurde von 374 deutschen Frauen aller
Schichten im Alter von 21 bis 77 Jahren unterschrieben, im
Nachrichtenmagazin "Stern" veröffentlicht und sorgte für
gewaltigen Zündstoff.
Ein weiteres wichtiges Thema war die
sexuelle Gewalt. Vergewaltigung und sexueller Missbrauch sowie
Misshandlungen in den Familien, in der "Privatsphäre", die
bisher in der Gesellschaft tabu waren, wurden nun ins Licht gerückt und
in ihrem Ausmaß sichtbar gemacht. In den Niederlanden, England und
Italien fanden große Aktionen unter dem Motto "Wir erobern uns die
Nacht zurück" statt. Frauenhäuser entstanden, Selbsthilfegruppen
und Notruftelefone wurden etabliert. Frauen protestierten und
prozessierten gegen Pornographie und erniedrigende Darstellung von Frauen
in den Medien. |
|
Appell "Ich
habe abgetrieben"
(6. Juni 1971 im "Stern")
Jährlich treiben in der Bundesrepublik rund
1 Million Frauen ab. Hunderte sterben, zehntausende bleiben krank
und steril, weil der Eingriff von Laien vorgenommen wird. Von
Fachärzten gemacht, ist die Schwangerschaftsunterbrechung ein
einfacher Eingriff. Frauen mit Geld können gefahrlos im In- und
Ausland abtreiben. Frauen ohne Geld zwingt der Paragraph 218 auf
die Küchentische der Kurpfuscher. Er stempelt sie zu
Verbrecherinnen und droht ihnen mit Gefängnis bis zu fünf
Jahren. Trotzdem treiben Millionen Frauen ab – unter
erniedrigenden und lebensgefährlichen Umständen.
Ich gehöre dazu. – Ich habe abgetrieben.
Ich bin gegen den Paragraphen 218 und für Wunschkinder.
Wir Frauen wollen keine Almosen vom Gesetzgeber und keine Reform
auf Raten!
Wir fordern die ersatzlose Streichung des Paragraphen 218!
Wir fordern umfassende sexuelle Aufklärung für alle und freien
Zugang zu Verhütungsmitteln!
Wir fordern das Recht auf die von den Krankenkassen getragene
Schwangerschaftsunterbrechung! |
|
Frauenprotest richtete sich auch gegen das
etablierte Gesundheitswesen. In autonomen Frauengesundheitszentren wurden
Selbstuntersuchungen propagiert und das ärztliche Diagnose- und Therapiemonopol
durchbrochen. Die Gesellschaft wurde als eine Ursache der vielen sogenannten
"Frauenleiden" benannt. Tribunale gegen gesundheitsschädliche Mittel
und Methoden der Pharmaindustrie sowie gegen frauenfeindliche Ärzte fanden
statt. Frauen stürmten Misswahlen und demonstrierten gegen das
Schönheitsdiktat.
Kunst und Kultur:
Überall entstanden Frauenprojekte:
Frauenzentren, , -verlage, -zeitungen, -buchläden, -werkstätten, -bands,
-theatergruppen, -cafes, -kneipen und –ferienhäuser. Frauenprojekte und –organisationen
vernetzten sich. Frauen sind nun nicht nur aus politischen Gründen zusammen,
sondern verbringen ihre Freizeit miteinander und haben Spaß.
Lust und Liebe:
Die Studentenbewegung hatte als erste die
gängige Sexualmoral in Frage gestellt und politisiert. Die sexualfeindliche
kleinbürgerliche Erziehung wurde als eine Ursache für die Herausbildung des
"autoritären Charakters" betrachtet. Daher trage die Sexualmoral zur
Anfälligkeit der Menschen für Faschismus und autoritäre Ideologien bei.
Sexualbefreiung wurde als Mittel zur Emanzipation gefeiert, in der Macht,
Abhängigkeit und Unterdrückung durch andere Menschen wegfallen sollte. Die
Einführung der Pille in dieser Zeit befreite die Frauen zunächst vom Druck der
Schwangerschaft und wurde euphorisch begrüßt. Doch die alten Tabus hatten auch
als Schutzzonen für Frauen fungiert und brachen nun weg.
Um so wütender waren die Frauen, als die Realität der Studentenbewegung, d.h.
sexuelle Verfügbarkeit und Anpassung an die Wünsche der Männer, sie eingeholt
hatte. Sie forderten nun die "Befreiung der weiblichen Sexualität".
Damalige Forschungsergebnisse widerlegten die psychoanalytischen Thesen der
angeblichen Überlegenheit des vaginalen Orgasmus (der nur durch Penetration zu
erreichen sei) und des "Penisneides" der Frau. Gleichzeitig wurde
über die Realität der gelebten Sexualität gesprochen, über Zwang und
Phantasielosigkeit. Der Penis als einziges Organ zur Erfüllung der weiblichen
Lust stand zur Disposition, neue Wege der weiblichen Sexualität wurden
diskutiert und ausprobiert. So manche Frau entdeckte in diesen Jahren die Liebe
zu Frauen, wie auch Lesben als Gruppe erstmals öffentlich in Erscheinung
traten.
Arbeit:
Die ökonomische Situation der Frau —
insbesondere das Thema Hausarbeit als unbezahlte Arbeit für Familie und
Gesellschaft "aus Liebe" und die Unterbezahlung von Frauenarbeit —
bildete den Mittelpunkt feministischer Analysen. Die unterschiedliche Bezahlung
in typischen Männer- und Frauenberufen wurde angeprangert. 1978 verklagte in
Deutschland eine Arbeiterin erstmals ihre Firma, da sie bei gleicher Arbeit
geringeren Lohn als ihre männlichen Kollegen erhielt — erfolgreich. Hunderte
weitere folgen. Beim Thema Hausarbeit kristallisierten sich zwei Strömungen
innerhalb der internationalen Frauenbewegung heraus:
Die "Unitaristinnen" gehen von der
prinzipiellen Gleichheit von Mann und Frau aus. Aufgrund dieses
Gleichheitsprinzips müssen für Männer und Frauen gleiche Bedingungen gelten,
d.h. Frauen müssen die gleichen Chancen im Berufsleben erhalten, die Hälfte
der Hausarbeit müsse vom Ehemann übernommen, Staat und Ehemann müssen bei der
Kindererziehung in die Pflicht genommen werden. Unitaristinnen wehren sich gegen
den "Mythos Mutter". Sie sind unter anderem in Deutschland stark
vertreten. Als Schwäche dieses Ansatzes wird kritisiert, dass Mutterschaft
wegen der fehlenden Möglichkeiten, Kinder und Beruf zu vereinbaren, abgelehnt
werde. Außerdem passe sich die Frau damit einseitig an die Prinzipien und
Denkweisen der Männerwelt an.
Die "Differentialistinnen" gehen
von der prinzipiellen Andersartigkeit von Frau und Mann aus. Sie sind
diejenigen, die in den 70er Jahren vehement Lohn für Hausarbeit forderten. Sie
befürworten Mutterschaft und sehen in der Mutter-Kind-Beziehung ein
gesellschaftskritisches Potential. Schwangerschaft, Gebären und Kindererziehung
werden als alternative Arbeit der Erwerbsarbeit gegenübergestellt,
"Mutterlogik" als weibliche Macht erklärt, die es zu schützen und
stützen gelte. Hochburg des differentialistischen Ansatzes ist Italien. Als
Schwäche dieses Ansatzes wird die Mystifizierung der traditionellen
Rollenzuschreibungen kritisiert. Lohn für Hausarbeit binde die Frauen noch mehr
an das Haus und die Familie Die Verantwortung der Väter und der Gesellschaft
für die Kindererziehung und ihr Wert für die kindliche Sozialisation werde
nicht untersucht.
Wissenschaft:
Ausgehend von der feministischen
Wissenschaftskritik wurde zunehmend Frauenforschung betrieben, immer mehr
wissenschaftliche und populärwissenschaftliche Publikationen zum Thema Frauen
erschienen. Frauen forschten in der Geschichte nach den Leistungen von Frauen
und stellten diese bisher unbekannte Hälfte der Geschichte der Öffentlichkeit
zur Verfügung. Nicht nur der Inhalt, auch die Art der Forschung wurde in Frage
gestellt und nach neuen Formen gesucht. Vor allem in den USA wurden innerhalb
der Universitäten Budgets und Personal für "Women’s Studies" zur
Verfügung gestellt. Heute sind "Gender Studies" ein unverzichtbarer
Teil der Forschung, auch wenn eine Revolutionierung des gesamten
Wissenschaftsbetriebs nicht gelungen ist.
Ergebnisse:
 | Das Familien- und
Eherecht wurde in vielen Ländern reformiert. Diskriminierung und
Ungleichbehandlung von Ehefrauen aus der bürgerlichen oder christlichen
Tradition teilweise aufgehoben und der Realität angepasst. In Deutschland
beispielsweise betraf dies die
Namensgebung (Familienname kann bei der Heirat sowohl der des Mannes wie
auch der der Frau sein), das Eherecht (Mann und Frau können gleichberechtigt
einem Beruf nachgehen, das Leitbild der "Hausfrauenehe" wurde
aufgehoben), das Scheidungsrecht (das Schuldprinzip wurde aufgehoben und ein
Versorgungsausgleich für die Ehefrau festgelegt) und das Sorgerecht (das Wohl
des Kindes steht nun im Vordergrund). |
 | Die "Fristenlösung"
bei der Abtreibung (straffreie Abtreibung bis zur zwölften Woche) wurde in
den meisten Ländern eingeführt, so in den USA, in Italien und Frankreich.
Dort, wo die Fristenlösung bei Beginn der Frauenbewegung bestand, wurde sie
erfolgreich gegen konservative Kräfte verteidigt (z.B. in England).
Deutschland ist eine Ausnahme. Hier wurde die Fristenlösung zweimal als
nicht verfassungskonform ("Schutz des Lebens" ist in der
Verfassung festgeschrieben) deklariert — 1975 und 1995. Heute gilt hier
die Indikationslösung, d.h. Abbruch ist bis zur zwölften Woche unter
bestimmten Bedingungen straffrei, die Schwangere ist zu einer Beratung
verpflichtet. |
 | "Quotierungen"
als zeitweiliges Mittel, um Frauen zu höheren Machtpositionen zu verhelfen. |
 | Gesetze zum Schutz
schwangerer Arbeitnehmerinnen (Arbeitsplatzsicherung) werden
verabschiedet. |
Die Frauenbewegung hatte in allen
gesellschaftlichen Bereichen einen kaum zu überschätzenden Einfluss — sowohl
auf der institutionellen wie auch auf privater Ebene, im Zusammenleben der
Geschlechter. Viele Forderungen haben nichts an Aktualität eingebüßt und
werden erst heute nach und nach umgesetzt (z.B. "Asylgrund Frau",
eingetragene Lebensgemeinschaften für homosexuelle Paare, Strafbarkeit von
Vergewaltigung in der Ehe etc.). Auch nach dem Abebben öffentlicher Aktionen
und trotz vielfacher Gegenbewegungen haben die Frauen als Gruppe ein
Selbstbewusstsein gewonnen, das nicht mehr vernachlässigt werden kann.
[Autorin: Dorette Wesemann, Redaktion: Ragnar
Müller]
[Seitenanfang]
|