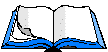 |
Was
versteht man unter "symbolischer Politik"?
|
Demokratische Herrschaft in einer
parteienstaatlich geprägten Wettbewerbsdemokratie (...) ist durch periodisch
wiederkehrende Wahlen zeitlich begrenzt. Da demokratische Politik an sich
begründungs- und zustimmungspflichtig ist, müssen sich Politik, politische
Entscheidungsträger und deren Handeln permanent vor der politischen
Öffentlichkeit rechtfertigen, diese über politische Planungen und
Entscheidungen informieren und Aufmerksamkeit erzeugen. Wahlkämpfe sind in
diesem Prozess Stoßzeiten der von den politischen Akteuren ausgehenden Suche
nach »Legitimation durch Kommunikation«. Dies darf jedoch nicht darüber
hinwegtäuschen, dass politische Kommunikation permanent stattfindet und auf
Dauer angelegt ist — nicht zuletzt deswegen, weil politisches Handeln selbst
auch kommunikatives Handeln ist.
Grundlegend für das Verständnis
von politischer Kommunikation ist das auf Murray Edelman zurückgehende Konzept
der »symbolischen Politik«. Edelmans Ansatz geht von einer Doppelung der
politischen Realität aus. Darunter versteht er, dass alle politischen
Handlungen und Ereignisse gekennzeichnet sind durch die Trennung in eine
instrumentelle Dimension bzw. einen Nennwert — die tatsächlichen Effekte der
politischen Handlung — und eine expressive Dimension bzw. einen
dramaturgischen Symbolwert — die Darstellung der Handlung für die
Öffentlichkeit. Die nach Edelman aus Sicht der politischen Akteure
rollenbedingte und unbewusste Inszenierung einer politischen Scheinwelt für den
Bürger durch politische Symbole sowie deren mystifizierende Ritualisierung für
und durch die Massenmedien überlagern zunehmend den Nennwert der politischen
Handlungen.
Daran anknüpfend unterscheidet
auch Ulrich Sarcinelli zwischen den Dimensionen der Herstellung (Erzeugung) und
der Darstellung (Vermittlung) von Politik, zwischen politischem Nenn- und
Symbolwert. Materielle (herstellende) Politik verliert nach Sarcinelli im
Medien- und vor allem im Fernsehzeitalter zunehmend den Bezug zum entscheidenden
Gestalten. Im Gegensatz dazu wird die »Mediatisierung« von Politik, d. h. die
massenmediale und vor allem fernsehgerechte Darstellung und »Verpackung« von
Politik, zur Aufrechterhaltung und Vortäuschung politischer
Steuerungsfähigkeit immer wichtiger. Sprachliche Symbole (Schlagwörter wie
»Euro«, »Steuerreform« etc.) und nichtsprachliche Symbole (Hymnen, Fahnen,
das Händeschütteln bei Staatsempfängen etc.) erzeugen Aufmerksamkeit. Sie
reduzieren zudem politische Problemkomplexität, vermitteln eine bestimmte
Weltsicht und wecken beim Publikum Emotionen.
Politische Symbole dienen jedoch
nicht nur der Vermittlung bzw. Darstellung politischer Realitäten. Im
Wettbewerb der Parteien und Politiker um Medienaufmerksamkeit können und werden
politische Symbole auch zur Vortäuschung einer politischen Scheinrealität
instrumentalisiert (werden). Für eben diesen konkreten Einsatz von politischen
Symbolen im Politikvermittlungsprozess steht der Begriff »symbolische
Politik«. Die mitunter unpräzise und meist abfällige Verwendung dieses
Begriffes im Alltagsgebrauch verdeutlicht die weitverbreitete Kritik an der
Symbolhaftigkeit der Politik. Sie übersieht jedoch, dass es Politik »pur«,
also eine politische Wirklichkeit zum »Nennwert« ohne Dramaturgie und ohne
symbolischen Zusatz, nicht geben kann. Seitdem politisch gehandelt wird, ist
symbolische Politik immer ein unausweichlicher Bestandteil politischer Realität
gewesen. Sie stellt ein Forum für politische Entscheidungsträger dar, sich zu
präsentieren, Problemlösungskompetenz unter Beweis zu stellen und politische
Grundorientierungen, Werte und Normen zu vermitteln. Da nun aber für die große
Mehrheit der Bevölkerung Politik in ihrer ganzen Komplexität nicht direkt
erfahrbar ist, wird, von der Öffentlichkeit weitestgehend unbemerkt, die
mediengerechte Darstellung von Politik in Form von Ritualen, Stereotypen,
Symbolen und geläufigen Denkschemata zur allgemein akzeptierten Vorstellung von
»politischer Wirklichkeit«: Während die Inszenierung von Politik für das
Publikum zur politischen Realität wird, bleibt das politische Handeln »hinter
der Medienbühne« aber weitestgehend im Dunkeln.
[aus: Jens Tenscher: Politik für
das Fernsehen – Politik im Fernsehen. Theorien, Trends, Perspektiven; in:
Ulrich Sarcinelli (Hg.), Politikvermittlung und Demokratie in der
Mediengesellschaft, Bonn BpB 1998]
|
|
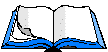
|
Was
bedeutet "Mediengesellschaft"?
|
Es versteht sich fast von selbst, dass sich
Medien, Mediensystem und Öffentlichkeit in offenen, demokratischen
Gesellschaften anhaltend im Wandlungsprozess befinden. Sie sind damit
für den Beobachter sowohl Indikatoren als auch relevante Faktoren zur
Beschreibung und Analyse des sozialen Wandels. In vielen
politikwissenschaftlichen oder soziologischen Betrachtungen fanden die
Medien und das Mediensystem bislang allerdings nur wenig Aufmerksamkeit.
Erst in letzter Zeit vollzieht sich ein rascher und grundlegender Wandel
— sowohl in der sozialen Realität wie auch bei den Beobachtern. Das
mag der Grund sein, weshalb in zahllosen sozialwissenschaftlichen
Reflexionen Schlagworte wie »Informationsgesellschaft« oder
»Mediengesellschaft« zur Charakterisierung des derzeitigen
Entwicklungsstandes verwendet werden. Mit den Begriffen wird generell
angezeigt, dass Herstellung, Verbreitung und Rezeption von Informationen
in der modernen Gesellschaft ökonomisch, kulturell und politisch an
Bedeutung gewinnen. Und mehr noch: Das Mediensystem wird zur zentralen
Infrastruktur der modernen Gesellschaft. Von »Mediengesellschaft« kann
gesprochen werden, weil
- die publizistischen Medien sich quantitativ
und qualitativ immer mehr ausbreiten,
- die Vermittlungsleistung von Informationen
durch die Medien sich enorm beschleunigt hat,
- sich neue Medientypen herausgebildet haben,
- Medien immer engmaschiger die gesamte
Gesellschaft durchdringen,
- Medien aufgrund ihrer hohen Beachtungs- und
Nutzungswerte gesamtgesellschaftliche Aufmerksamkeit erlangt haben und
Anerkennung beanspruchen,
- und sich letztlich zu Institutionen
entwickeln.
Medien werden zugleich mehr und mehr zur
Voraussetzung für die Informations- und Kommunikationspraxis anderer
Akteure. Pointiert formuliert: Ohne publizistische Medien gibt es keine
Kommunikation zwischen gesellschaftlichen Organisationen wie zwischen
Organisationen und dem allgemeinen Publikum. Folglich ist die politische
Öffentlichkeit in modernen Demokratien hinsichtlich ihrer Struktur, der
Inhalte und der Prozesse weitgehend medial beeinflusst. Im Hinblick auf
die politische Sacharbeit und ihre Darstellung ergeben sich für alle
Akteure, die auf die Entstehung allgemeinverbindlicher Entscheidungen
einwirken, neue Anforderungen.
[aus: Otfried Jarren: Medien, Mediensystem
und politische Öffentlichkeit im Wandel; in: Ulrich Sarcinelli (Hg.),
Politikvermittlung und Demokratie in der Mediengesellschaft, Bonn BpB
1998]
[Seitenanfang]
|